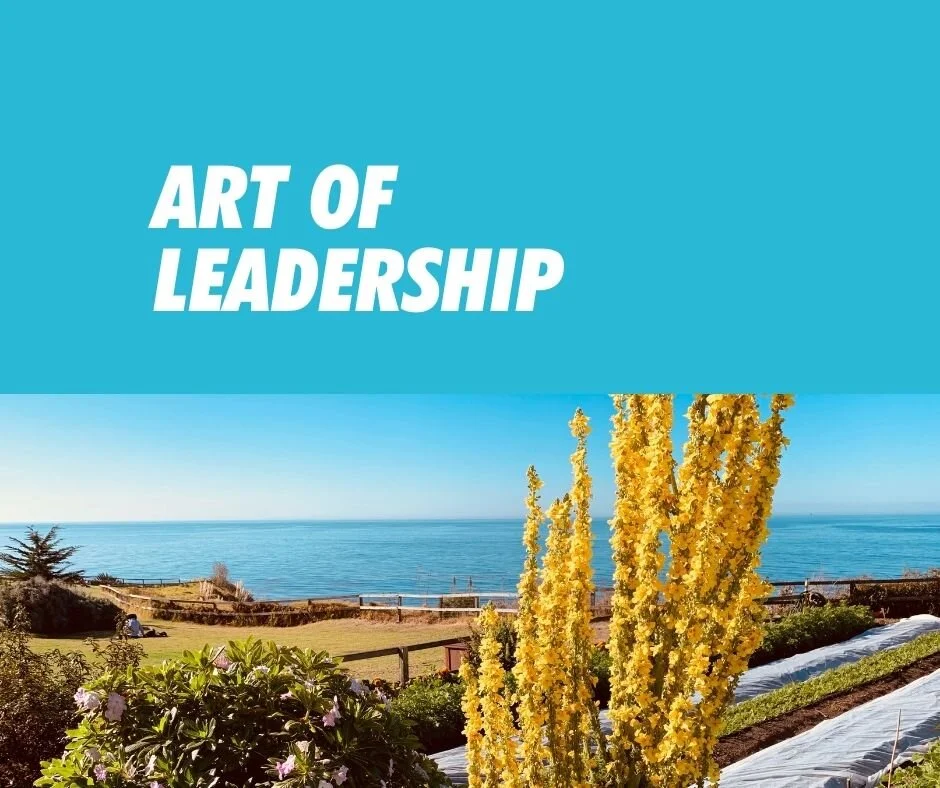Wenn Erfolg bestraft und sabotiert wird
Haben Sie schon einmal erlebt, dass Ihre beruflichen Erfolge nicht gefeiert, sondern kleingeredet oder gar sabotiert wurden? Dass Kolleginnen und Kollegen Ihre Ideen herunterspielen oder Ihnen vorwerfen, zu ehrgeizig zu sein?
Ich habe dieses Phänomen immer wieder erlebt, egal ob in Organisationen oder im privaten Umfeld. Auch ich habe mich immer wieder dabei ertappt, über meine Erfolge lieber nicht zu sprechen, weil ich oft unbewusst Neid gespürt habe. Denn die Erolgreichen sind oft nicht diejenigen, denen man es vergönnt, sondern hofft, dass diese auch scheitern.
In Neuseeland und Austrialien wurde dafür ein Begriff gefunden -
das sogenannte Tall-Poppy-Syndrom (TPS). Was dahinter steckt, warum das so ist und wie und daran hindert, selber erfolgreich zu sein , darum geht es in diesem Blog.
Was ist das Tall-Poppy-Syndrom?
TPS (Tall Poppy Syndrome) bezeichnet die Tendenz, erfolgreichen, talentierten oder hoch angesehenen Menschen mit Missgunst, Groll oder Spott zu begegnen. Es beinhaltet auch die Neigung, die eigenen Erfolge oder Talente herunterzuspielen, um Neid oder Spott von anderen zu vermeiden.
Der Begriff stammt aus einer Metapher:
In einem Feld voller Mohnblumen (Poppy) wird die höchste Blüte (Tall) abgeschnitten, um das Feld auf eine einheitliche Höhe zu bringen.
Das Tall-Poppy-Syndrom beschreibt die Tendenz, besonders erfolgreiche oder herausragende Personen zu kritisieren, zu untergraben oder sogar aktiv an ihrem Aufstieg zu hindern.
Die Ursprünge dieses Denkens reichen weit zurück. Der römische Historiker Livius erzählt von König Tarquinius, der die höchsten Blüten in seinem Garten abschnitt, um seinem Sohn zu symbolisieren, dass er in einer eroberten Stadt die führenden Persönlichkeiten ausschalten solle.
Vor allem aber ist es in Organisationen und Unternehmen erfahrbar, mit folgenden Erscheinungsformen, wie am folgenden Beispiel erkennbar:
Technologiekonzern: Ein hochqualifizierter junger und hochengagierter Ingenieur entwickelte eine innovative Lösung zur Kostenreduzierung in der Produktion. Anstatt Anerkennung zu erhalten, wurde er von seinen Vorgesetzten ignoriert, da sie fürchteten, dass seine Ideen ihre eigene Position gefährden könnten und erkennbar wird, dass die Prozesse ineffizient sind.
Interessensvertretung: Eine hochtalentierte, junge Managerin wird aus der Privatwirtschaft in eine Interessensvertratung geholt - besser als Kammer bekannt. Als Abteilungsleiterin sprüht sie vor Ideen, Vorschlägen und Verbesserungen, wird aber von anderen nur blockiert - sie bekommt keinen Zugang zu Ressourcen, wird vertröstet und sonst kalt gestellt. Nach einem Jahr kündigt sie wieder!
Bei diesem Syndrome spielen die sozialen und emotionalen Phänomene wie Neid, Missgunst und Schadenfreude eine zentrale Rolle:
Was sind Neid und missgunst?
Wenn man sich dieser Thematik nähert muss man sich diesem Begriff von verschiedenen Seiten nähern.
Gesunder Neid kann motivieren: Man sieht jemanden mit einer tollen Fähigkeit oder einem guten Leben und denkt: Das will ich auch, also arbeite ich daran.
Zerstörerischer Neid führt dazu, dass man dem anderen sein Glück nicht gönnt, weil es das eigene Unglück sichtbarer macht.
Missgunst geht noch einen Schritt weiter, denn ist nicht nur der Wunsch, das Gleiche zu haben, sondern der auch dass der andere es nicht mehr haben soll. Missgunst ist destruktiver als Neid, weil sie nicht nur auf den eigenen Mangel schaut, sondern aktiv das Glück oder den Erfolg des anderen zerstören will.
Beispiel für den Unterschied:
Neid: „Mein Kollege hat eine Gehaltserhöhung bekommen. Ich hätte das auch gerne!“
Missgunst: „Mein Kollege hat eine Gehaltserhöhung bekommen – das ist unfair, er verdient das nicht! Ich hoffe, er fällt bald auf die Nase.“
Während Neid oft aus einem Gefühl des Mangels kommt („Ich will auch haben, was du hast“), entsteht Missgunst oft aus einer tieferen Frustration oder Verbitterung („Wenn ich es nicht haben kann, dann sollst du es auch nicht haben“). Es ist die aktive Ablehnung von Glück oder Erfolg bei anderen – besonders, wenn man glaubt, dass der andere es nicht „verdient“ hat. Und es bekommt dann eine destruktive Seite, dass ich dem Anderen proaktiv Schaden zufüge, soweit es in meinem Machtbereich ist.
Wie werden diese Phänomen sichtbar?
Gerüchte und Intrigen (jemanden schlechtreden, damit er an Ansehen verliert):
Verweigerung von Hilfe (jemanden bewusst nicht unterstützen, obwohl man es könnte)
Sabotage (jemandem Steine in den Weg legen, um ihn scheitern zu sehen)
Das macht Missgunst gefährlicher als bloßen Neid. Neid kann motivieren, sich selbst zu verbessern, aber Missgunst will den anderen aktiv herunterziehen.
Was ist dann Schadenfreude?
Schadenfreude ist die Freude am Unglück anderer. Sie tritt oft als Folge von Missgunst auf:
Wenn man jemanden beneidet, aber nichts tun kann, um ihn zu „stürzen“, freut man sich vielleicht, wenn ihm von selbst etwas Schlechtes passiert. Es ist eine Art „heimliche Genugtuung“: Man fühlt sich besser, weil der andere fällt – selbst wenn man selbst dadurch keinen Vorteil hat.
Jemand, der dich immer überholt, stolpert und fällt – und du denkst: „Geschieht ihm recht!“
Ein arroganter Chef wird gefeuert – und du empfindest ein befriedigendes Gefühl.
Ein Freund gewinnt im Lotto, gibt alles aus und ist danach pleite – und du sagst: „Tja, hätte er mal besser aufgepasst.“
URSACHEN UND gRÜNDE
Einen spannenden Aspekt dazu liefert der österreichsiche Arzt und Psychoanalytiker Wilhelm Reich, der dieses sozialpsychologische Phänomen im Buch Christusmord beschrieben hat. In diesem Buch setzt sich Reich mit der tiefen Feindseligkeit auseinander, die lebendigen, kreativen und freien Menschen entgegenschlägt.
Zentral ist Reichs These, dass an einer Art gesellschaftlich verankerter Neurose leidern, die sich gegen alles Lebendige und Spontane richtet. Der „Christusmord“ steht für das immer wiederkehrende Muster, dass Menschen, die für Freiheit, Wahrheit und natürliche Lebensenergie eintreten, systematisch unterdrückt oder zerstört werden.
Wilhelm Reich argumentiert, dass Menschen, die das Lebendige, Spontane und Natürliche unterdrücken, dies nicht nur aus bewusstem Hass oder Neid tun, sondern weil sie selbst tief blockiert sind. Ihre eigenen Ängste, Zwänge und gesellschaftlichen Prägungen verhindern, dass sie frei und ungehemmt leben – und genau deshalb bekämpfen sie diejenigen, die es tun.
Menschen, die selbst unfähig sind, frei zu fühlen und zu handeln, erleben diejenigen, die es können, als Bedrohung. Sie greifen diese an, um ihre eigene innere Starre zu schützen. Es ist einfacher, die freie Person zu vernichten, als die eigene Blockade zu lösen.
Auswirkungen
In einer spannenden Studie aus dem Jahre 2022 (Kirkwood & McNaughton (2022) wurden die Befragten (über 250) gefragt, wie sie TPS erlebt haben. In mehr als 40 % der Fälle trat es durch persönliche Gespräche auf, während soziale Medien mit großem Abstand an zweiter Stelle standen.
Aber die Auswirkungen für die Betroffenen waren massiv, in professioneller und persönlicher Hinsicht:
TPS hemmt Ambition und Potenzial: 77 Kommentare beschrieben die Auswirkungen von TPS als hemmend für Ambitionen, Selbstvertrauen und Potenzial der Betroffenen. Einige Beispiele:
Es erstickt Innovation und Kreativität
Angst, Stress, Sebstzweifel oder Mobbing sind die Folge
Mehrere Eltern hochbegabter Kinder äußerten auch, dass ihr Kind TPS erlebe – und dass sie als Eltern ebenfalls betroffen seien, ein Phänomen, das wir als „TPS by proxy“ bezeichnen. Beispiele hierfür:
Was könnte man tun?
Wenn ich dieses Phänomen beobachte und selbst erlebe, beginnt alles mit der Akzeptanz, dass ich diese Gefühle habe. Doch oft wollen wir uns das nicht eingestehen, da es sozial nicht opportun erscheint – schließlich gilt es als unangebracht, neidisch zu sein. Dabei lieben wir es insgeheim, wenn einst hochgefeierte Stars fallen – das lässt sich unschwer an den zahlreichen Kommentaren in den Medien über frühere Ikonen wie Grasser, Kurz oder Benko erkennen.
Dann braucht es natürlich die Bereitschaft, sich der eigenen Unlebendigkeit zu stellen – zu erkennen, dass ich meine eigenen Potenziale nicht lebe, dass ich meine Gefühle auf andere projiziere und dass ich es nicht ertrage, wenn andere besser sind. Sich das einmal ehrlich einzugestehen, wäre bereits ein großer Schritt. Noch wichtiger ist es jedoch, die dahinterliegenden Emotionen wie Wut, Hass und Angst nicht nur zuzulassen, sondern sie auch bewusst auszudrücken.
Dies würde nicht nur viel mehr Potenzial entfalten, sondern auch Neid und Missgunst verringern. Und genau jetzt ist eine gute Zeit dafür.
Autor: Werner Sattlegger, Founder der Art of Life
Events:
Bücher und Links
"Tall Poppy Syndrome: Navigating Challenges to Lift Us All" (2024): Eine Studie über weibliche Führungskräfte in Regierungsorganisationen, die TPS erleben.
Kirkwood & McNaughton (2022): Eine Studie in Neuseeland zeigt, dass Unternehmer oft mit abwertenden Bemerkungen zu kämpfen haben, was zu Selbstzweifeln und Emigration führen kann. (University of Auckland)
Werner Sattlegger: “Die Kunst reifer Führung”
Executive Silicon Valley Learning Journey, 02. Juni - 06.Juni, 2025
Autor: Werner Sattlegger
Founder & CEO Art of Life
Experte für digitale Entwicklungsprozesse, wo er europäische mittelständische Familien- und Industrie-unternehmen von der Komfort- in die Lernzone bringt. Leidenschaftlich gerne verbindet er Menschen und Unternehmen, liebt die Unsicherheit und das Unbekannte, vor allem bewegt ihn die Lust am Gestalten und an Entwicklung.